Ist Deutschlands Aufrüstung ein wirtschaftlicher Befreiungsschlag oder ein Trugschluss
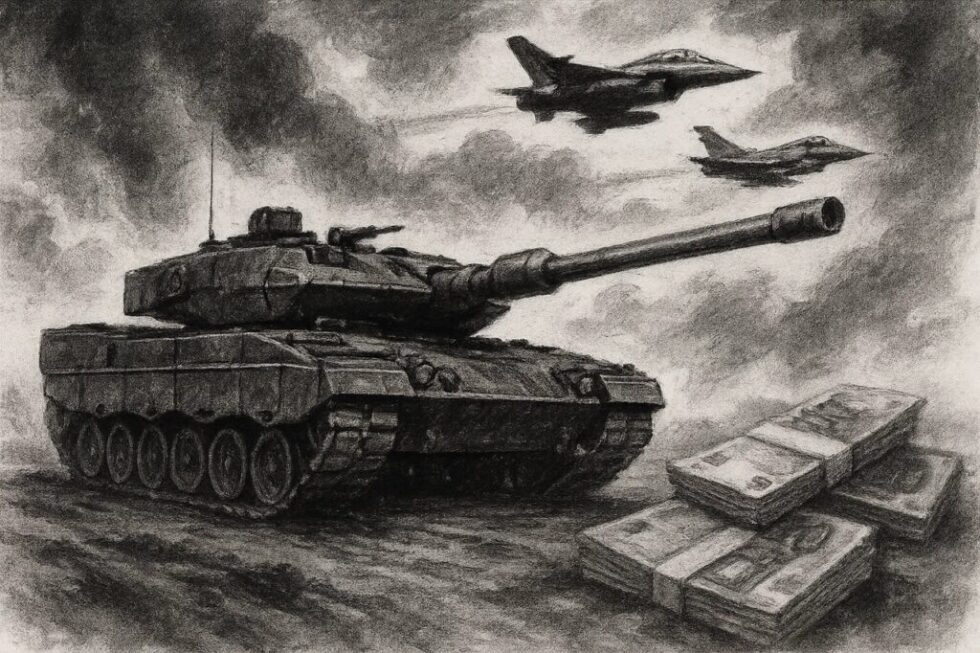
Inmitten einer wirtschaftlichen Stagnation wagt Deutschland einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel historischen Ausmaßes: Die Bundesregierung investiert massiv in Rüstung, mit dem Ziel, sowohl die nationale Sicherheit zu stärken als auch die konjunkturelle Flaute zu überwinden. Doch führende Ökonomen und Industrieanalysten zeigen sich skeptisch, ob militärische Ausgaben tatsächlich ein nachhaltiger Wachstumsmotor sein können. Darüber berichtet Renewz.de unter Berufung auf eine Analyse der Xinhua News Agency.
Paradigmenwechsel: Von Exportmodell zur Rüstungswirtschaft
Deutschlands Wirtschaft basierte jahrzehntelang auf Exportstärke – insbesondere in den Sektoren Automobilindustrieund Maschinenbau. Doch globale Krisen, Lieferkettenprobleme, steigende Energiepreise und zunehmende Handelskonflikte, vor allem mit den USA, setzen diesem Modell zunehmend Grenzen. Die Exporte in die Vereinigten Staaten sind seit drei Monaten rückläufig und erreichten zuletzt den niedrigsten Stand seit Februar 2022.
Als Reaktion darauf entschied sich die Bundesregierung im März 2025 für einen radikalen Schritt: Der Bundestag stimmte für die Lockerung der Schuldenbremse, um die Verteidigungsausgaben langfristig zu erhöhen – ein Schritt, der in Friedenszeiten in der Bundesrepublik beispiellos ist.
Ziel: 3,5 Prozent des BIP für Verteidigung
Die geplanten Verteidigungsausgaben sollen laut dem verabschiedeten Plan bis 2029 auf 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts steigen. Das entspricht rund 162 Milliarden Euro, ein deutliches Plus gegenüber dem NATO-Ziel von 2 %, das Deutschland erstmals 2024 wieder erreichte.
Kanzler Friedrich Merz kündigte an, er wolle „die stärkste konventionelle Armee Europas“ aufbauen – unter dem Druck des Ukraine-Krieges sowie wachsender Zweifel an der Verlässlichkeit der USA unter Präsident Donald Trump.
Milliarden für die Rüstungsindustrie
Bereits 2026 sollen 83 Milliarden Euro in die Bundeswehr fließen – ein Anstieg von 55 % gegenüber dem Vorjahr. Geplant sind unter anderem:
| Projekt | Hersteller | Details |
|---|---|---|
| 20 Eurofighter-Kampfjets | Airbus, BAE Systems, Leonardo | Teil europäischer Luftverteidigung |
| Tausende Boxer-Panzer | Rheinmetall | Modernisierung der Landstreitkräfte |
| 60 Großprojekte | Diverse Anbieter | Noch 2025 zur Genehmigung vorgesehen |
Rheinmetall, inzwischen Europas fünftgrößter Rüstungshersteller, profitiert erheblich. Die Aktie stieg seit Anfang 2025 um über 30 %. Doch Experten warnen: Profit ist nicht gleich Produktivität.
Rüstungsausgaben als schwacher Konjunkturimpuls
Ökonomen wie Prof. Dr. Tom Krebs von der Universität Mannheim sprechen von einem begrenzten Multiplikator-Effekt:
„Ein Euro Militärinvestition erzeugt nur rund 50 Cent zusätzliches BIP“, erklärt Krebs.
Zum Vergleich: Investitionen in Bildung, digitale Infrastruktur oder frühkindliche Betreuung führen oft zu doppelt oder dreifach höheren Effekten. Zudem profitierten primär einige wenige Großunternehmen von den Aufträgen – nicht aber die breite Bevölkerung oder der Mittelstand.
Weitere Risiken:
- Lange Produktionszeiten für komplexe Rüstungsgüter
- Automatisierte Fertigung mit geringer Beschäftigungswirkung
- Rückzug ziviler Firmen aus anderen Industrien zugunsten der Rüstung
- Inflationäre Tendenzen durch mangelnden Wettbewerb im Rüstungssektor
Stimmen der Skepsis: „Keine langfristige Lösung“
Katherina Reiche, Bundeswirtschaftsministerin, sieht die Verteidigungsindustrie zwar als „unverzichtbaren Baustein wirtschaftlicher Resilienz“. Doch selbst sie warnt:
„Die Industrie ist kein Allheilmittel gegen strukturelle Probleme.“
Auch Zheng Chunrong von der Tongji-Universität mahnt zur Vorsicht:
„Rüstungsausgaben sind endlich. Wer nur auf militärischen Stimulus setzt, riskiert langfristige Ungleichgewichte.“
Zwischen strategischer Notwendigkeit und wirtschaftlicher Sackgasse
Deutschlands historisch hohe Verteidigungsausgaben spiegeln eine tiefgreifende sicherheitspolitische Verunsicherung wider – gleichzeitig jedoch auch eine ökonomische Orientierungslosigkeit. Die Hoffnung, durch militärische Investitionen wirtschaftliche Impulse zu setzen, beruht auf einem kurzfristigen Effekt mit begrenztem strukturellem Nutzen. Studien zufolge beträgt der volkswirtschaftliche Multiplikator von Rüstungsausgaben lediglich 0,5, während Investitionen in Bildung, Digitalisierung oder soziale Infrastruktur signifikant höhere Wachstumsraten erzielen.
Langfristig birgt der Fokus auf Rüstungsausgaben erhebliche Risiken:
- Verdrängung produktiver zukunftsorientierter Sektoren,
- Abhängigkeit von politischen Verteidigungsetats,
- fehlende Innovationsdynamik außerhalb der Sicherheitsindustrie.
Anstelle einer Rüstungswirtschaft braucht die größte Volkswirtschaft Europas gezielte Investitionen in menschliches Kapital, technologische Transformation und ökologische Nachhaltigkeit, um ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu sichern.
Bleiben Sie informiert! Lesen Sie auch: Warum Spotify In Deutschland Teurer Wird – Und Was Abonnenten Nun Wissen Müssen





