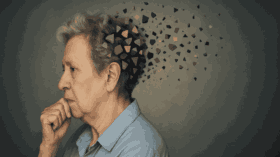Was bedeutet ein erhöhter Prolaktinwert – und was tun bei Hyperprolaktinämie
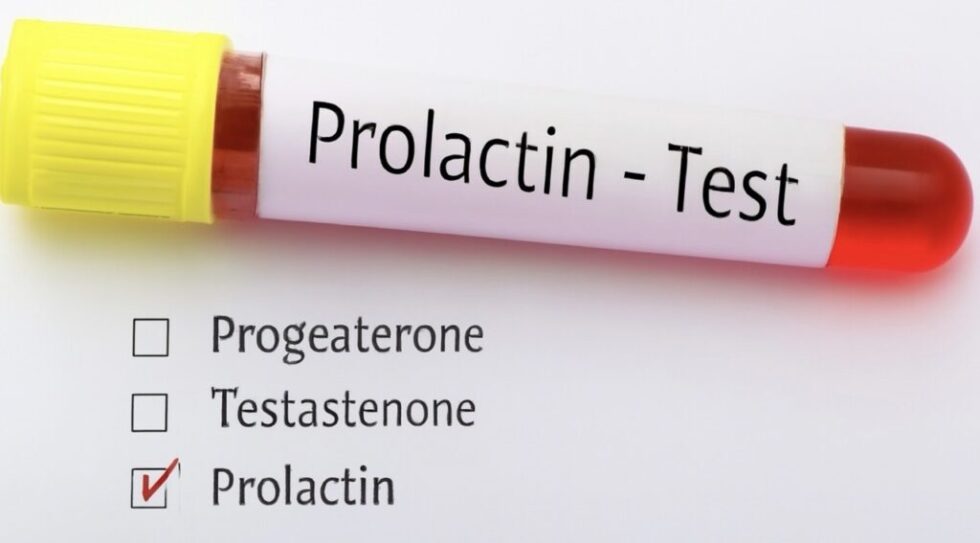
Was ist Prolaktin und warum ist es wichtig? Prolaktin ist ein Hormon, das im Vorderlappen der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) gebildet wird. Es ist primär für die Milchproduktion nach der Geburt verantwortlich, hat aber eine wesentlich weiterreichende Wirkung. Prolaktin reguliert unter anderem den weiblichen Zyklus, beeinflusst die Fruchtbarkeit beider Geschlechter, wirkt auf den Stoffwechsel, die Stimmungslage sowie das Immunsystem. Bei Männern kontrolliert es über indirekte Rückkopplungsmechanismen den Testosteronspiegel und wirkt auf die Spermienproduktion.
Ein dauerhaft erhöhter Prolaktinwert – die sogenannte Hyperprolaktinämie – kann eine Vielzahl klinischer Symptome verursachen und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Häufig wird die Störung erst spät erkannt, da die Symptome unspezifisch sein können. Darüber berichtet Renewz.de auf Basis aktueller Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (2025).
Warum ist die Kontrolle des Prolaktinspiegels notwendig
Ein aus dem Gleichgewicht geratener Prolaktinspiegel kann zu tiefgreifenden hormonellen Veränderungen führen. Zu den möglichen Folgen zählen Zyklusstörungen, Libidoverlust, unerfüllter Kinderwunsch, Stimmungsschwankungen und bei Männern Erektionsprobleme. Unbehandelt kann Hyperprolaktinämie auch zur Reduktion der Knochendichte (Osteoporose-Risiko), zur Milchabsonderung ohne Schwangerschaft oder zu Tumorbildungen im Bereich der Hypophyse führen. Die Früherkennung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen hormonellen Stabilisierung. Oft genügt bereits eine einfache Blutuntersuchung zur Bestätigung. Aus diesem Grund fordern Fachgesellschaften regelmäßige Laborchecks bei betroffenen Patientengruppen. Besonders empfohlen wird eine Prolaktinkontrolle bei: Zyklusstörungen, unerklärlicher Galaktorrhö, Libidoverlust oder ungewollter Kinderlosigkeit.
Mögliche Ursachen für erhöhtes Prolaktin
Erhöhte Prolaktinwerte können durch eine Vielzahl physiologischer, medikamentöser oder krankhafter Prozesse verursacht werden. Besonders häufig sind hormonelle Dysbalancen, die durch Stress, Schilddrüsenerkrankungen oder bestimmte Medikamente ausgelöst werden.
Funktionelle oder hormonelle Ursachen
- Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose)
- Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS)
- Hypogonadismus bei Männern (Testosteronmangel)
- Schwangerschaft oder Stillzeit (physiologisch erhöht)
- Hormonelle Dysbalancen durch Stress, Schlafmangel, Essstörungen
Medikamentös bedingte Ursachen
| Medikamentengruppe | Beispiele | Wirkung auf Prolaktin |
|---|---|---|
| Neuroleptika | Haloperidol, Risperidon | Dopaminhemmend |
| Antidepressiva | SSRI, trizyklische AD | Hemmung der Rückkopplung |
| Dopaminantagonisten | Metoclopramid, Domperidon | direkte Erhöhung |
| Östrogenpräparate | Kombinierte Kontrazeptiva | indirekt stimulierend |
| Blutdrucksenker | Verapamil | mögliche Nebenwirkung |
Tumoren der Hypophyse
- Mikroprolaktinom (<10 mm)
- Makroprolaktinom (>10 mm)
- Andere hypophysäre Tumoren mit sekundärer Prolaktinerhöhung
Symptome bei erhöhter Prolaktinproduktion
Ein dauerhaft erhöhter Prolaktinspiegel äußert sich bei Frauen und Männern in unterschiedlichen, teils unspezifischen Symptomen. Bei Frauen gehören Zyklusstörungen, ausbleibende Monatsblutungen (Amenorrhö) sowie eine unerklärliche Milchabsonderung aus der Brust (Galaktorrhö) zu den häufigsten Warnzeichen. Auch unerfüllter Kinderwunsch, Libidoverlust, depressive Verstimmungen und eine erhöhte Müdigkeit können Hinweise auf eine Hyperprolaktinämie sein. Männer zeigen hingegen häufiger Potenzprobleme, ein Nachlassen des sexuellen Verlangens sowie eine Brustvergrößerung (Gynäkomastie). Darüber hinaus kann es zu eingeschränkter Spermienqualität, Stimmungsschwankungen und Muskelschwäche kommen. In beiden Geschlechtern bleibt die Diagnose oft verzögert, da die Symptome langsam einsetzen und nicht immer eindeutig zugeordnet werden.
Frauen
- Ausbleibende oder unregelmäßige Menstruation (Amenorrhö, Oligomenorrhö)
- Galaktorrhö (Milchfluss ohne Geburt)
- Unfruchtbarkeit durch ausbleibende Ovulation
- Libidoverlust, vaginale Trockenheit
- Zyklusverkürzung oder -verlängerung
- Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen
- Akne oder vermehrte Körperbehaarung
Männer
- Libidoverlust, erektile Dysfunktion
- Gynäkomastie (Brustentwicklung)
- Reduzierte Spermienproduktion
- Unfruchtbarkeit, reduzierte Ejakulation
- Stimmungsschwankungen, Depression
- Verminderte Muskelmasse
- Chronische Müdigkeit
Normwerte für Prolaktin (ng/ml)
| Geschlecht / Alter / Zustand | Normwert |
| Männer (bis 50 Jahre) | 2–18 ng/ml |
| Männer (über 50 Jahre) | 2–20 ng/ml |
| Frauen (bis 35 Jahre) | 2–29 ng/ml |
| Frauen (35–50 Jahre) | 2–25 ng/ml |
| Frauen (nach Menopause) | 2–20 ng/ml |
| Schwangere Frauen | 34–386 ng/ml |
| Stillende Frauen | 68–699 ng/ml |
Abweichungen von diesen Werten sollten immer ärztlich abgeklärt werden. Werte über 100 ng/ml gelten als behandlungsbedürftig, insbesondere wenn kein physiologischer Grund (z. B. Stillzeit) vorliegt.
Die Behandlung eines erhöhten Prolaktinspiegels richtet sich nach der Ursache, dem Schweregrad der Erhöhung sowie den bestehenden Beschwerden. In vielen Fällen genügt eine medikamentöse Therapie, bei funktionellen Ursachen können jedoch auch Lebensstiländerungen ausreichen. Ziel ist stets, den Prolaktinwert zu normalisieren, die Hormonbalance wiederherzustellen und Folgekomplikationen wie Infertilität oder Zyklusstörungen zu vermeiden. Die Behandlung sollte stets unter endokrinologischer Betreuung erfolgen. Bei Prolaktinomen ist eine langfristige Kontrolle unerlässlich, da Rückfälle auch nach erfolgreicher Therapie möglich sind.
Medikamentöse Therapie (erste Wahl)
Dopaminagonisten senken direkt die Prolaktinausschüttung im Hypophysenvorderlappen:
Wirkstoff Handelsname Anwendung Vorteil Cabergolin Dostinex® 1–2 × pro Woche Lange Wirkdauer, gute Verträglichkeit Bromocriptin Parlodel® 1–3 × täglich Klassisch, kostengünstig Diese Medikamente können Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schwindel oder niedrigen Blutdruck verursachen, insbesondere zu Beginn der Therapie. Eine langsame Eindosierung unter ärztlicher Aufsicht ist daher Standard.
Operative Entfernung (nur bei bestimmten Patienten)
Ein chirurgischer Eingriff ist nur notwendig, wenn:
- ein Makroprolaktinom vorliegt, das auf Medikamente nicht anspricht
- das Sehvermögen durch den Tumor gefährdet ist
- starke Nebenwirkungen eine medikamentöse Therapie unmöglich machen
Die Operation erfolgt in der Regel transsphenoidal (durch die Nase) und wird in spezialisierten neurochirurgischen Zentren durchgeführt.
Strahlentherapie (selten)
Kommt nur in Betracht, wenn weder Medikamente noch eine Operation ausreichend wirksam sind. Die Wirkung tritt verzögert ein (mehrere Monate bis Jahre).
Lebensstilbasierte Maßnahmen (unterstützend, bei leichter Hyperprolaktinämie)
Diese können unterstützend oder bei funktionell erhöhtem Prolaktin hilfreich sein:
- Stressabbau: Meditation, Achtsamkeit, Schlafhygiene
- Bewegung: moderater Ausdauersport wie Walking, Radfahren
- Verzicht: Reduktion von Alkohol, Koffein, Nikotin
- Schlaf: 7–8 Stunden, regelmäßiger Rhythmus
- Ernährung: magnesium- und vitaminreiche Kost (z. B. B6, Zink)
Bei leichten Formen (z. B. stressbedingtem Prolaktinanstieg) kann ein gesunder Lebensstil ausreichend sein, um den Wert zu stabilisieren – sofern Tumore ausgeschlossen wurden.
Diagnostik: So wird erhöhter Prolaktinwert erkannt
- Blutentnahme morgens (zwischen 8–10 Uhr) im nüchternen Zustand
- Wiederholungsmessung zur Bestätigung
- Kontrolle von TSH, fT3, fT4 zur Ausschluss einer Hypothyreose
- MRT der Hypophyse bei anhaltend hohem Wert
- Gynäkologischer Ultraschall (bei Zyklusstörungen)
- Spermiogramm (bei männlicher Infertilität)
Empfehlungen für Patientinnen und Patienten
Wann sollte ich zum Arzt
- Bei unregelmäßigem Zyklus über 3 Monate
- Unerklärlichem Milchfluss ohne Geburt
- Libidoverlust, Erektionsproblemen
- Depressiven Verstimmungen ohne erkennbare Ursache
- Bei unerfülltem Kinderwunsch (Männer und Frauen)
Welche Untersuchungen sind notwendig
- Hormonstatus inkl. Prolaktin, TSH, LH, FSH
- MRT (bei anhaltender Erhöhung)
- Ultraschall oder Spermiogramm zur Differenzierung
Ein erhöhter Prolaktinspiegel ist eine ernstzunehmende, aber gut behandelbare hormonelle Störung. Dank moderner Diagnostik und wirksamer medikamentöser Therapieformen kann die hormonelle Balance in den meisten Fällen wiederhergestellt werden. Voraussetzung ist ein frühzeitiger Arztbesuch, die richtige Interpretation der Symptome und eine umfassende Abklärung der Ursache.
Bleiben Sie informiert! Lesen Sie auch: Wo Nimmt Man Zuerst Ab – Gesicht, Bauch Oder Hüften? Die Reihenfolge Überrascht!